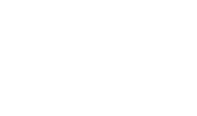Homepage 主页
Welcome to the website of the Professorship for East Asian History at the Albert-Ludwig University of Freiburg, Germany, held by Prof. Dr Sabine Dabringhaus. Our focus in research and teaching lies in the history of East Asia and Southeast Asia, as well as their role on the international stage in modern history.
欢迎浏览达素彬 (Sabine Dabringhaus) 教授主持的阿尔伯特 - 路德维希 - 弗莱堡大学东亚史教席的网站。本教席的主要教学与研究项目包括东亚及东南亚史,也关注现代史中该区域在国际社会扮演的角色。